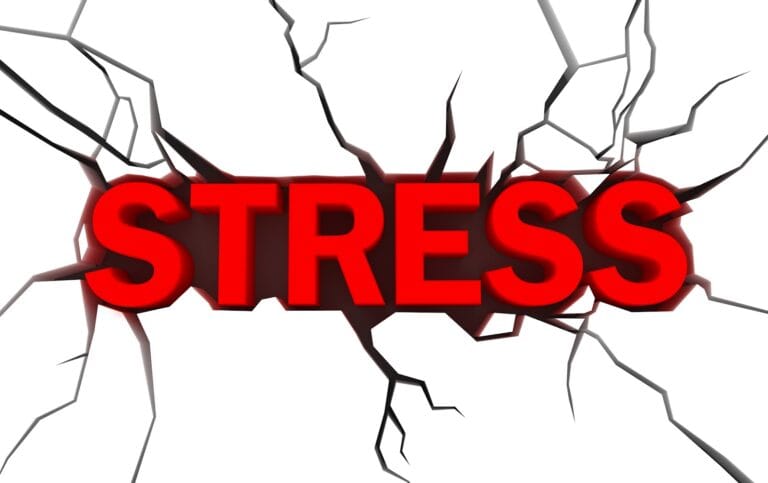Was ist eine posttraumatische Belastungsstörung?
In unserem Sprachgebrauch wird „Trauma“ oft mit dem Bild einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) gleichgesetzt. Wir sprechen von Trauma, wenn ein Ereignis das Leben eines Menschen aus der Bahn geworfen hat. Eine genauere Unterscheidung lohnt sich aber: Ein potentiell traumatisches Ereignis löst nicht zwingend eine PTBS aus. Manche Menschen erholen sich von selbst wieder und finden zurück in einen Zustand von Sicherheit.
Bei anderen bleibt der Stress, der während der traumatischen Situation entstand, im Körper hängen. Das hat gravierende und langfristige Folgen für die Betroffenen.
Die drei Kernsymptome von PTBS
Wiedererleben (Intrusionen)
Ein zentrales Merkmal von PTBS ist das sogenannte Wiedererleben. Betroffene erleben das Trauma ungewollt und plötzlich erneut, oft in Form von Flashbacks oder sehr real wirkenden Erinnerungen. Es fühlt sich dann so an, als würde das Geschehene genau jetzt wieder stattfinden – mit denselben Gefühlen, Bildern und körperlichen Reaktionen wie damals. Auch Albträume, die sich wiederholen und stark belasten, gehören dazu. Das Wiedererleben tritt meist unvermittelt auf, manchmal ausgelöst durch bestimmte Geräusche, Gerüche oder Situationen, die an das Trauma erinnern. Diese Auslöser werden als Trigger bezeichnet.
Vermeidung
Weil diese Erinnerungen so quälend sein können, versuchen viele Betroffene, alles zu vermeiden, was sie daran erinnert. Das können Orte, Gespräche oder auch bestimmte Tätigkeiten sein. Manche Menschen gehen sehr weit in diesem Vermeidungsverhalten, ziehen sich sozial zurück oder unterdrücken Gefühle. Auf den ersten Blick wirkt das wie eine hilfreiche Schutzstrategie, langfristig verstärkt es jedoch oft die Belastung, weil wichtige Lebensbereiche eingeschränkt werden. Ausserdem ist ein Abschliessen mit dem Erlebten so nicht möglich. Es bleibt lediglich unter Verschluss, während der Stress ungebrochen anhält.
Anhaltende Übererregung (Hyperarousal)
PTBS-Betroffene leben häufig in einem Zustand ständiger Alarmbereitschaft. Ihr Körper reagiert so, als ob permanent Gefahr droht; das Nervensystem rechnet jederzeit damit, dass „es“ wieder passieren kann. Typische Folgen sind Schlafstörungen, eine erhöhte Schreckhaftigkeit, Konzentrationsprobleme und Reizbarkeit. Manche berichten auch davon, dass sie kaum zur Ruhe kommen oder ständig angespannt sind. Dieses „Dauer-Alarm-System“ ist kräftezehrend und wirkt sich auf den gesamten Alltag aus.
Weitere häufige Symptome
Neben diesen drei Hauptmerkmalen gibt es noch eine Reihe weiterer Beschwerden, die nach einem Trauma auftreten können. Nicht jeder erlebt sie alle, und die Ausprägung kann sehr unterschiedlich sein. Einige der häufigsten weiteren Symptome sind:
- Gefühl von Entfremdung: Manche Betroffene spüren kaum noch Nähe zu anderen oder fühlen sich, als stünden sie außerhalb ihres eigenen Lebens.
- Negative Gedanken und Gefühle: Häufig treten Schuldgefühle, Scham oder das Gefühl auf, wertlos zu sein. Auch ein dauerhaft negatives Selbstbild oder Misstrauen gegenüber anderen gehören dazu.
- Körperliche Symptome: Der Körper zeigt oft ebenfalls Reaktionen – von Kopf- und Bauchschmerzen bis zu anhaltender innerer Unruhe, wobei für die Beschwerden meistens keine medizinische Begründung gefunden wird
- Dissoziation: In manchen Momenten fühlen sich Betroffene wie von sich selbst oder ihrer Umgebung abgetrennt. Das kann ein Gefühl der Taubheit sein oder die Wahrnehmung, als sei die Welt unwirklich. Dissoziation ist ein weites Spektrum und kann sich auf zahlreiche unterschiedliche Arten zeigen!
Viele Betroffene machen sich Selbstvorwürfe, weil sie im Alltag nicht mehr so gut funktionieren oder sich in Beziehungen anders verhalten als vor dem traumatischen Ereignis. Aber eine PTBS ist keine „Schwäche“ und kein „Versagen“. Sie ist eine verständliche, angemessene Reaktion des Körpers und der Psyche auf ein extrem belastendes Ereignis. Das Wort „Trauma“ stammt aus dem Griechischen und bezeichnet „Wunde“. Genau wie eine körperliche Wunde auch, benötigt eine seelische Wunde Zeit und eine angemessene Versorgung, um zu heilen. Dabei müssen Betroffene nicht allein bleiben. Es lohnt sich, Hilfe zu suchen.
Quellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Posttraumatische_Belastungsst%C3%B6rung
Bessel Van der Kolk – Verkörperter Schrecken
Peter Levine – Trauma-Heilung / Trauma und Gedächtnis / Sprache ohne Worte